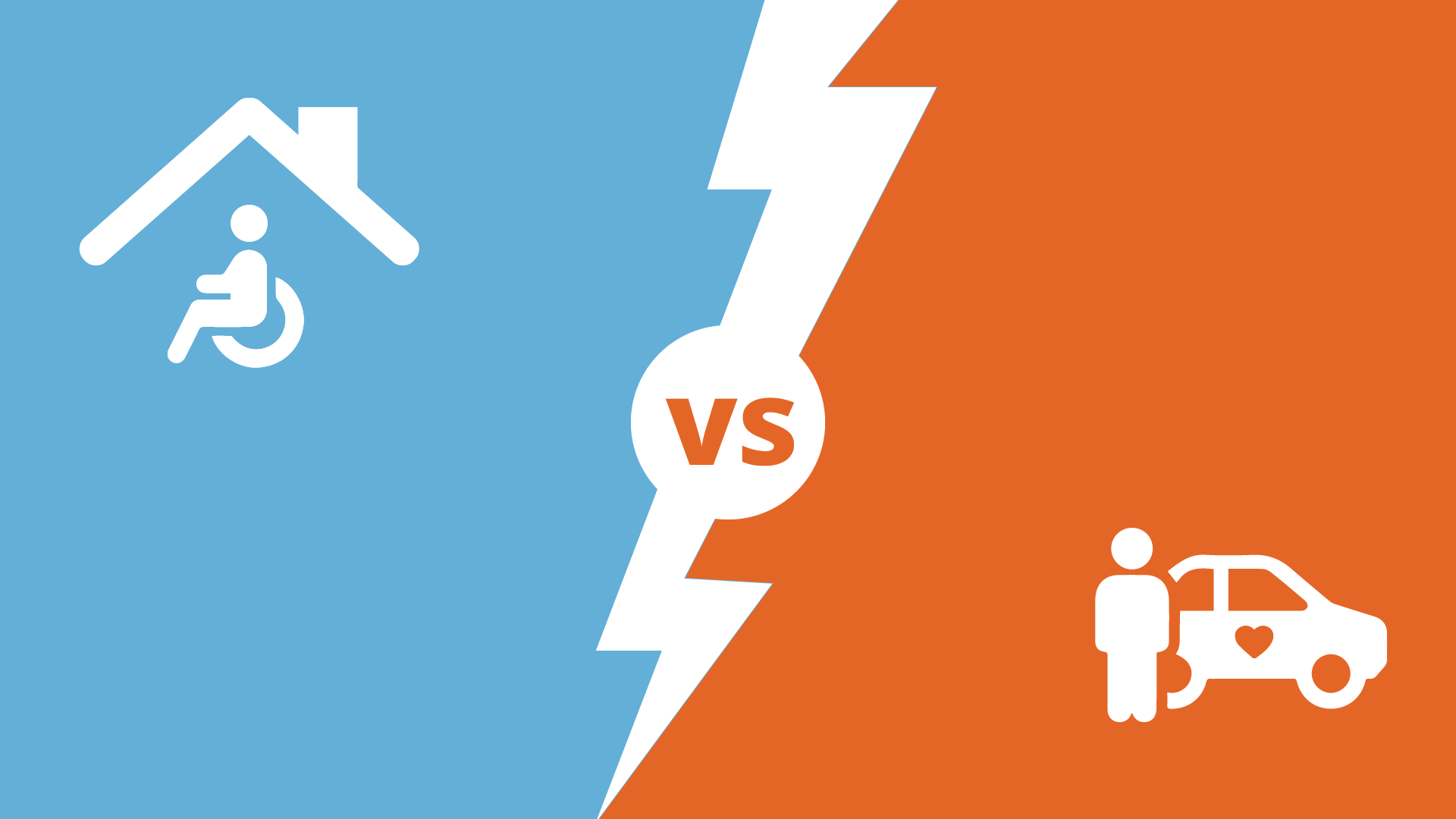
20.10.2023
Pflegeheime verabreichen auffällig viele ruhigstellende Medikamente
Der AOK-Pflegereport 2023 hat im letzten Monat vor allem mit der Meldung für Schlagzeilen gesorgt, dass in vielen Pflegeheimen auffällig viele ruhigstellende Medikamente verabreicht werden. Das betrifft einerseits Demenzpatient*innen, deren für andere spürbare Symptome so abgestellt werden, aber auch Patient*innen ohne Demenzerkrankungen. Außerdem gibt viele Pflegeheime, in denen an Demenz erkrankte Bewohner*innen häufig aufgrund von Dehydration (Flüssigkeitsmangel) ins Krankenhaus müssen.
Auffällig sind einerseits die in vielen Fällen hohen Anteile. Aber andererseits auch die starken Schwankungen: es gibt riesige Unterschiede zwischen den Durchschnittswerten der Bundesländer (grob sind die neuen Bundesländer besser als die alten und NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schneiden am schlechtesten ab).
Der AOK-Report enthält keine Spekulationen oder Hinweise auf Gründe für die Unterschiede.
Stresszustände im Pflegeheim?
In Kommentaren unter Artikeln zum Thema sammeln sich Erlebnisberichte von Angehörigen und Pflegefachkräften. Sie berichten, dass die Medikamente zum Ruhigstellen eingesetzt werden – nicht als Unterstützung einer Therapie oder akute Intervention.
Vorgesehen ist der Einsatz von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln maximal für vier Wochen. Sie sind sonst gefährlich für die Gesundheit und können abhängig machen. Eigentlich sollte dabei auch ein Arzt mitreden. In der Realität sind – nach Berichten in den Kommentaren – die Mittel aber wohl in einigen Pflegeheimen „Routine“ und werden von Pflegekräften angefordert. Das überrascht vor allem, weil die „Diagnose“-Kompetenz von Pflegekräften in allen anderen Bereichen formal nicht mal für Pflaster genügt.
Pflegeheim vs. ambulanter Pflege?
Bei den Berichten geht es um die Versorgung in Pflegeheimen. In früheren Studien hat sich gezeigt, dass die ambulante Versorgung beispielsweise in Intensivpflege-WGs wesentlich sicherer für die Patient*innen ist – das lässt sich sicher auch auf den besseren Pflegeschlüssel zurückführen. In der ambulanten Intensivpflege liegt er bei 1:1 – eine Quote, die nicht nur für Patient*innen angenehmer ist, sondern auch für Pflegekräfte.
Hier kann auch eine potenzielle Erklärung für die Ruhigstellungskrise in den Pflegeheimen liegen: eine ruhiggestellte, schlafende Person verlangt einfach weniger Aufmerksamkeit. So wie schreiende oder weinende Kinder früher Milch mit Mohn (Achtung: auch heute noch lebensgefährlich!) oder sogar Alkohol zum Schlafen bekamen, würden heute eben diejenigen in Pflegeheimen ruhiggestellt. Das ist aus Sicht der überforderten Pflegekräfte vor Ort absolut nachvollziehbar! Zumal der routinierte, gewohnte Umgang mit den Mitteln oft auch suggeriert, sie seien nicht gefährlich. So entsteht ein Teufelskreis, in dem Betäubungsmittel normalisiert und dann noch häufiger verteilt werden.
In der ambulanten Pflege ist dieses „Risiko“ niedriger, weil sich in jeder beliebigen Situation eine Pflegekraft nur um eine Person zur Zeit kümmert. Auch wenn der nächste Termin drängt, steht beim Hausbesuch nicht physisch eine andere schreiende/weinende Person daneben und verlangt nach Aufmerksamkeit.
Folgeforderung: mehr Analyse der Krankenkasseninformationen
Die Folgeforderung aus der Studie ist nun, mehr Krankenkassendaten kontinuierlich zu analysieren. Die Daten sollen nicht mehr nur in einzelnen Studien ausgewertet werden, sondern zur Überwachung der Pflege eingesetzt werden.
Natürlich kann so etwas hilfreich sein: wenn in einem Pflegeheim plötzlich die Zahl der Verordnungen für Beruhigungsmittel steigen, kann das jemand prüfen. Und nach der sachlichen Prüfung entscheiden, was ein guter nächster Schritt wäre. Immerhin kann es gute Gründe für viel Stress an einem Ort – oder einfach statistische Anomalien! – geben.
Auf der Suche nach konstruktiven Folgen
Das absehbare Problem ist zweigeteilt: erstens ist die Perspektive der Prüfung längst keine neutrale mehr – Probleme entstehen, weil in der Pflege Geld fehlt und das System überlastet ist. Das ist kein Geheimnis, aber von dieser Deutung hält sich die AOK und die Studie fern. Es gibt also keine wohlwollende Prüfung, die das Ergebnis haben kann „Oh, der Pflegeschlüssel sollte anders aussehen“ oder „Wow, diese Stresssituation scheint zu entstehen, weil Pflegekräfte Leistungsquoten erreichen müssen“. Stattdessen dreht sich so eine Untersuchung schnell in die Suche nach den bei den Pflegekassen und der Politik so beliebten „schwarzen Schafen“ der Pflege – sind die Werte zu hoch, hat man ein Pflegeheim gefunden, das falsch arbeitet.
Hier liegt auch die zweite Falle: eine reine Analyse bietet nur Messzahlen und wenn auf auffällige Messwerte keine kompetente qualitative Untersuchung folgt, optimieren bald alle Pflegeheime nur noch nach Messzahlen. Das ist selten förderlich für die tatsächliche, wahrnehmbare Qualität einer Leistung. Beispielsweise lässt sich die Zahl der Krankenhauseinweisungen durch Dehydration dadurch reduzieren, dass dehydrierte Menschen nicht ins Krankenhaus eingewiesen werden, sondern man vor Ort versucht, den Notfall irgendwie zu behandeln. Und wenn bestimmte Schlafmittel geprüft werden, kann man die Verordnungszahl senken, indem andere Mittel verabreicht werden, deren Nebenwirkung Müdigkeit ist.
Statt also nur nach mehr Daten, Zahlen und Informationen zu rufen, sollte der dringende nächste Schritt ein Nachdenken über Ursachen und Abhilfen sein.